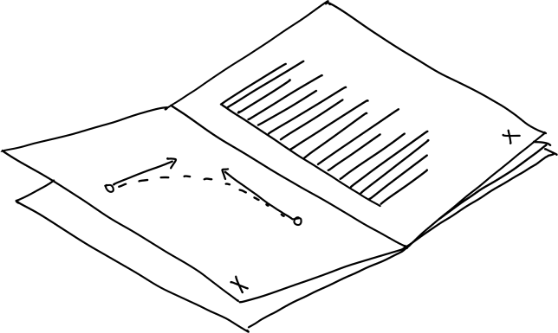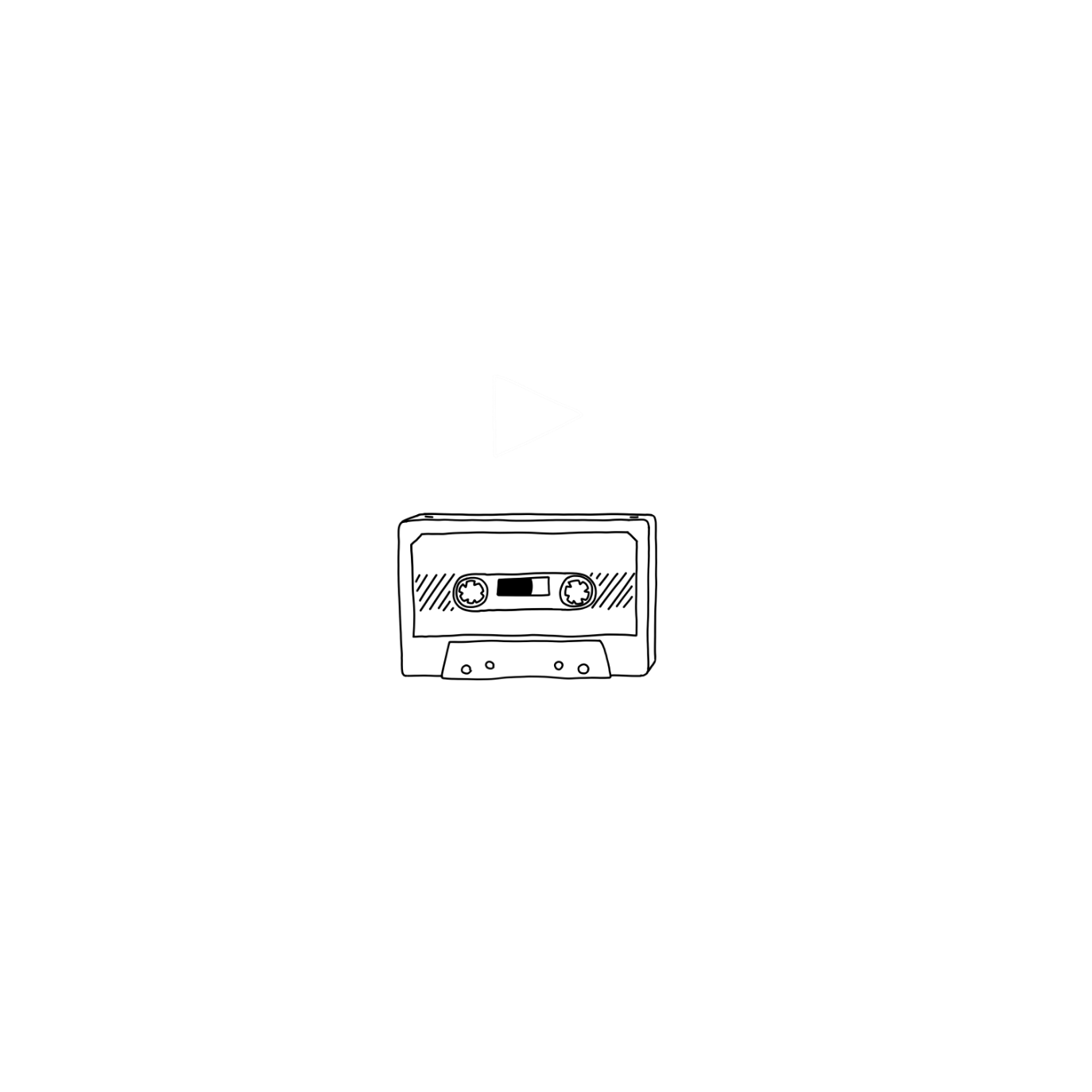
Fehlerkulturen
„Ich habe meine Photos abgeholt“, erzählt sie mir, „Die Minolta macht ganz andere Bilder, als meine Einwegkameras.“
„Alles andere würde mich verwundern!“
„Ja, aber die sind deutlich schärfer, da geht das analoge fast
verloren.“
„Was du vermisst ist die Plastiklinse“, korrigiere ich.
Sie unternimmt einen weiteren Erklärungsversuch. Dabei weiß
ich genau, was sie meint – will es aber nicht verstehen. Es widerstrebt mir anzuerkennen, dass Bildfehler und eine schlechte Abbildungsqualität ein ganzes Medium bestimmen soll. Ist es wirklich das, was allgemein unter einer analogen Photographie verstanden wird? Wenn ich absichtlich mit einer verkratzten Plastiklinse photographiere, um eine analogere Bildsprache zu erzielen: Wo liegt der Unterschied zum Instagram-Filter auf dem Handyphoto?! Jedes Medium hat seine Fehler. Sie gehören zum Medium dazu. Damit können Kratzer auf dem Film oder die Farbverschiebung einer gealterten Emulsion – unter anderem – Merkmale analoger Photographie sein. Touché. Dass daraus zuweilen interessante Effekte entstehen können, soll ebensowenig abgestritten werden. Dennoch möchte ich dies dem Fehler an sich – dem Reiz des Zufälligen – zuschreiben, nicht dem Analogen.
Der Fehler an sich beschreibt im Folgenden wertfrei all jene Phänomene, die zwischen dem Bild und dem Gegenstand liegen. „Schiebt sich nun ein technischer Apparat – zum Beispiel eine
Filmkamera – zwischen diese physikalische Ausgangsstruktur und
unsere Wahrnehmung, ist anzunehmen, dass sich eine irgendwie gestaltete Transformation der Abbildungsbeziehung überlagert,“▼ wie sie hier Fehler oder auch Störung genannt wird.▼ „Ein transparenter technischer Apparat würde keine Transformation verursachen: das Bild wäre dann identisch mit der wahrgenommenen Ausgangsstruktur, die Störung würde den Wert Null annehmen. Am anderen Ende der Skala steht die völlige Transformation bis zur Unkenntlichkeit. Dazwischen sind Myriaden von Abstufungen denkbar. Verschiedene Ursachen können Störungen auslösen, von Elementen des technischen Apparats über die Eigenschaften eines Speichermediums bis zu den Bearbeitungsprozessen in der Postproduktion. Gespeicherte Informationen können sich durch Alterungsprozesse verändern oder durch die Beschaffenheit eines Wiedergabesystems mit zusätzlichen Störungen angereichert werden.“▼
Das markanteste Beispiel für Störungen in der (analogen) Photographie ist wohl die Filmkörnung. „Im Unterschied zum Pixel, der durch eine feste Position innerhalb des geometrischen, horizontalen und vertikalen Bildrasters definiert wird, sind die Körner in der analogen Filmemulsion zufällig verteilt.“▼ Das hat (besonders im kinematographischen Film) den Effekt, dass unbewegte Szenen durch die wandernden Bildpunkte nicht erstarren; wirkt sich aber auch im analogen Bild allgemein auf die ästhetische Wahrnehmung aus.
Oftmals wird Filmkorn aus verschiedenen Gründen nachträglich auf digital erzeugte Bilder gerechnet: „1. um digitales Material an bereits vorhandenes dokumentarisches oder analog produziertes Material anzupassen; 2. um die Historizität eines digital produzierten Bildes zu behaupten; 3. um aus ästhetischen Gründen einen Filmlook herzustellen.“▼
Denn, „[d]as digitale Bild hat ein Problem: Es wirkt zu perfekt.“▼ 1993 stellt Paul Virilio die Hypothese auf, das digitale Bild werde „dereinst wirklicher erscheinen […] als die Sache, deren Bild es ist.“▼ 2004 schreibt Flückiger, dies sei bis heute nicht eingetroffen. Siebzehn Jahre später, behaupte ich, die stetig wachsende Auflösung (der digitalen Photosensoren, wie Wiedergabegeräte) fordert die hyperrealistische Darstellung regelrecht ein. Der moderne Photoapparat erzeugt per Default ein helles, dynamisches, kontrastreiches Bild, das gelegentlich Momente so genau manifestiert, wie sie zum Augenblick der der Aufnahme niemand der Anwesenden wahrgenommen hat. Dunkle Areale werden durch Interpolation abgewedelt, Ausgebrannte nachbelichtet, die Vignette und Distortion des Objektivs werden ausgeglichen. Diese Prozesse werden heute weitgehend intern vom Prozessor der Kamera automatisiert ausgeführt und es müsste aktiv dagegengesteuert werden (um den Hyperrealismus zu vermeiden). Auch „[i]n den klassischen Theorien, die sich mit den Transformationen des filmischen Bildes beschäftigen, schwang immer das Paradigma mit, dass der kinematografische Apparat alles daran setze, seine eigene Existenz zu verbergen. Es schien also, als ob größtmögliche Transparenzen des Apparats das unausgesprochene Ziel aller technischen Entwicklungen bilden sollte, ein Ziel, dem die Hochglanz-Breitwand-Produktionen der 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts so nah wie nie waren.“▼
Wo liegt also der Charme der verkratzen Plastiklinse – oder weniger offensiv: Der Reiz eines nur fast perfekt geschliffenen Glases aus den späten 1970er Jahren? Warum erfahren längst überwundene Störungen, die den Apparat als solchen sichtbar machen, plötzlich eine Renaissance? Und warum werden Fehler nachgeahmt, die Apparate affektieren, die nicht genutzt wurden? „Wenn man die Grundpfeiler Kausalität und Ähnlichkeit betrachtet, die klassischerweise eine gelungene Abbildung bestimmen, so ist die imitierte analoge Störung in beiden Fällen etwas Aufgepfropftes, dem tatsächlichen Prozess Überlagertes. Sie weist nicht auf den Abbildungsgegenstand hin, sondern auf ein Abbildungsverfahren und bildet damit eine mehrfache Referenzialität, man könnte auch sagen eine Referenzialität höherer Ordnung, die jenem Komplex zuzuordnen ist, den Barthes als Mythos bezeichnet hat. Mythen treten in dieser Konzeption immer dann auf, wenn eine kulturelle Praxis zur reinen Materie hinzutritt und ihre Bedeutung verändert. Diese kulturelle Praxis figuriert auch unter dem Begriff Konvention.
Damit eröffnen sich in [Flückigers] Argumentation zwei neue Bedeutungsfelder: Die Kategorie des Natürlichen vs. die Kategorie der Konvention. In Fragen umformuliert: Ist das analoge fotografische Bild natürlicher oder ist es lediglich stärker konventionalisiert als das digitale? Und wo liegen überhaupt die Unterschiede?
Beide Kategorien beschreiben Formen der Transparenz, man könnte auch sagen Formen der Selbstverständlichkeit, mit denen Rezipienten ein ästhetisches Angebot annehmen und verstehen. Das Natürliche wäre dabei jene Transparenz, die durch die Alltagserfahrung im direkten Umgang mit der Umwelt gegeben ist, während das Konventionelle seine Transparenz durch Gewöhnung an eine regelhafte Transformation erlangt. Die analoge Störung im digitalen Bild kann in beiden Zusammenhängen gesehen werden.“▼
Dabei verwundert mich, dass sich in der digitalen Photographie bis heute keine eigene Fehlerkultur entwickelt hat. Staub auf dem Sensor ist unerwünscht, zeugt von einer schlecht gewarteten Kamera und erfordert lästige Retusche. Pixel-, Interpolationsfehler und JPEG-Artefakte vermisst auch niemand an seiner neuen Digicam. „Es stellt sich […] die Frage, ob die Störung des digitalen Bildes in diesem Licht gesehen werden darf. Ist das digitale Bild tatsächlich schon so stark konventionalisiert, dass wir es einer Revision unterwerfen müssen? Haben wir es, anders gefragt, kulturell bereits gemeistert? Oder sollen die analogen Störungen die digitalen Ecken und Kanten weichspülen? Handelt es sich, anders gefragt, um einen postmodernen Romantizismus, um Nostalgie und Verklärung?“▼
Flückiger 2004: 407▲
vgl. Flückiger 2004: 407▲
Flückiger 2004: 407 f▲
Flückiger 2004: 410▲
Flückiger 2004: 410 f▲
Flückiger 2004.: 407▲
Virilio, P (1993): Revolutionen der Geschwindigkeit. Mervwe, Berlin. Nach: Flückiger 2004: 407: 56▲
Virilio 1993: 424 f▲
Flückiger 2004: 425▲
Flückiger 2004: 428▲