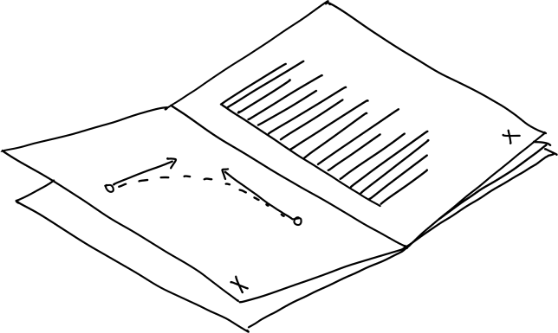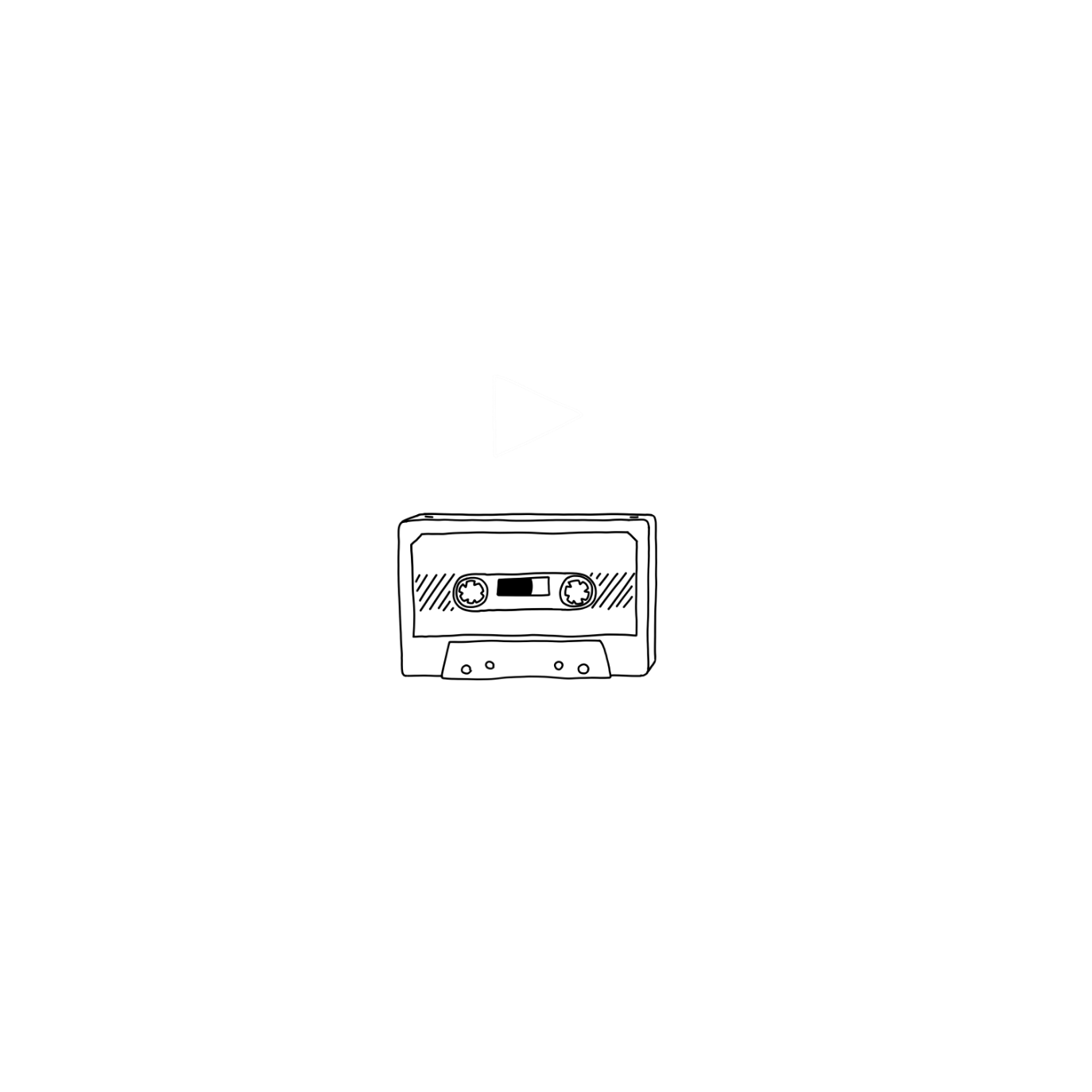
Analoges und digitales (Be-)Schreiben
F steht auf, um ihr Frühstück wegzuräumen. Ich kauere vor
dem Kühlschrank.
„Kann man dir helfen?“ F öffnet die Spülmaschine.
„Neein“ mein Kopf versinkt zwischen meinen Knien.
„Worüber denkst du nach? Woran zweifelst du noch?“
Ein Stöhnen: „An der Sinnhaftigkeit meines Masterstudiums!“
„Das machst du schon die ganze Zeit, das hilft dir nicht. Ich glaube, da kannst du noch lange d’rüber nachdenken, da ändert sich nichts; das hilft dir nicht! Du musst es einfach machen – etwas machen.“
Ich richte mich auf und beginne zu schreiben.
F beginnt Teller in den Schrank zu stapeln. „Wieso zweifelst du denn an deinem Masterstudium? Du arbeitest doch die ganze Zeit daran. Warum machst du denn, was du machst?“
„Ich habe immer nur gemacht, auf was ich gerade Lust hatte.“
„Aber es hat doch ein Thema – du hast doch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst. Das muss man doch in eine Forschungsfrage packen können. Ich glaube, du stellst dich an.“
Ich tippe.
Während sie sich reckt um die Tassen auf die zweite Schrankebene zu hieven, wirft sie mir einen Blick über die Schulter. „Ich wusste, dass du jetzt wieder soetwas schreibst!“
Kurz überlege ich, vom Notizheft zum Rechner zu wechseln. Geschriebenes ließe sich leichter korrigieren, ändern und sowieso ist eine automatische Rechtschreibkorrektur nicht die allerunpraktischste Erfindung. Im Hinblick auf mein Projektvorhaben entschließe ich mich dagegen. Wie würde sich das Ergebnis vom Handgeschriebenem unterscheiden?
Einige Stunden später sitze ich nach einem ausführlichen Gespräch (über unsere MA-Themen) mit einem Glas Wein in der Küche und muss J dabei beobachten, wie er versucht eine mechanische Tastatur an sein Smartphone anzuschließen … ▼
( J ist am Smartphone gescheitert und hat in der Zwischenzeit sein Macbook herangezogen, um das mechanische Biest▼ daran anzuschließen.) Er verkündet, schon über „eine Seite“ geschrieben zu haben – nur sehe ich kein Papier.
Wie sich analoge und digitale Kommunikation unterscheiden lässt, muss sich auch das Schreiben unterscheiden lassen. Ein Teil, der sich differenzieren lässt, ist schlicht und offensichtlich das Medium. Es lässt sich mit einem Stift schreiben: Der Text, der verfasst wird, bleibt kodifiziert (er besteht aus einer Aneinanderreihung symbolischer Zeichen) die Formen dieser Zeichen entstehen jedoch analog zur Bewegung der Hand. Der geschriebene Text bleibt in dieser Form einzigartig. Es lässt sich stets nachvollziehen, was gestrichen, ergänzt oder geändert wurde. Niemand – auch nicht die schreibende Person selbst – kann ihn genau so erneut aufs Papier bringen. Er kann photokopiert werden, damit entsteht eine Reproduktion, jedoch keine Duplikation des Objekts. Der Text kann händisch abgeschrieben werden; dabei entsteht lediglich eine Kopie des kodifizierten Inhalts. Das Geschriebene selbst (meist Tinte auf Papier) entsteht dabei von Grund auf neu. Die übrigen Informationen, die vom Schriftbild selbst abgelesen werden können, gehen verloren beziehungsweise entstehen neu. Etwa, in welcher Geduld oder Eile der Text geschrieben wurde, ob die Hand der schreibende Person entspannt oder verkrampft war, ob sie eine geübte Handschrift besitzt; woraus sich wiederum eine Vermutung über persönliche Umstände, wie das Alter ziehen lässt
2017 wurde das gesamte Originalmanuskript des Romans Der Prozess im Martin-Gropius-Bau in Berlin erstmals als gesamtes Werk gezeigt. Durch die Betrachtung der handschriftlichen Aufzeichnungen lässt sich nachvollziehen, wie Franz Kafka gearbeitet hat. „Das ist sehr ungewöhnlich. Viele Autoren arbeiten […] so, dass im Kopf eigentlich schon alles fertig ist, wenn sie zu schreiben beginnen, […] dann ist das Manuskript nicht so interessant. Aber wenn […] jemand so spontan arbeitet wie Kafka, […] kann man die Sofortkorrekturen sehen. Man kann sehen, wie er zurückschreckt vor einem Einfall und ihn durchstreicht. Man kann […] an dem Manuskript [sehen], wie er sich selbst erregt bei bestimmten Szenen, mit denen er sich sehr stark identifiziert. [Das ist] zum Beispiel daran [zu erkennen], dass ihm Fehler passieren. Auf der letzten Seite [die Szene der Hinrichtung] schreibt er plötzlich ‚ich‘ statt ‚er‘. Das ist unglaublich. Das ist ein handwerklicher Fehler größten Ausmaßes, würde man bei einem durchschnittlichen Autor sagen, in einem Roman, der in Er-Form geschrieben ist, hat das Wort ‚ich‘ nichts zu suchen, und das unterläuft Kafka. Je […] mehr man über Kafka weiß, desto mehr sieht man, was in diesen Blättern passiert ist, was in diesem Arbeitsprozess genau passiert ist […][Man] sieht […], dass er sich sehr identifiziert hat mit der Story, die er beschreibt. Das sieht man an den Fehlleistungen, man sieht es auch an der Schrift. Manchmal wird die Schrift dann hektisch, wenn er sich sehr erregt. [In] seinem Kopf ist das alles völlig real. Das ist wie ein sehr intensiver Tagtraum. Man kann schon an solchen Details sehen, welcher Rauschzustand das gewesen sein muss. Er ist völlig abgetaucht. [In seinem Tagebuch beschreibt er], welches wunderbare Gefühl das ist, so abtauchen zu können. Das hat in dem Manuskript viele Spuren hinterlassen.“▼
Ein mit einem Eingabestift auf einem Graphiktablet geschriebener Text nimmt diese Informationen ebenfalls mit auf, verbindet im Übrigen jedoch alle Vorteile des digitalen Mediums in sich: Das Geschriebene kann endlos dupliziert werden und Vorgänge lassen sich rückgängig machen oder wiederholen. Damit können Prozesse sichtbar gemacht werden, verlieren jedoch gleichzeitig an Überzeugungskraft.
Beim Tippen auf einer Tastatur werden diese Eigenschaften nie
festgehalten. Die Bewegung der Hand reduziert sich auf ein digitales Drücken des Fingers: Er drückt die Taste oder er drückt sie nicht. Es wird die pure Information der Zeichenabfolge festgehalten. Die Verbindung der Bewegung der Hand zum geschrieben Text ist dabei aber so abstrakt, dass keine persönlichen (atmosphärischen, phänomenologischen) Gegebenheiten übertragen werden.
Dennoch gibt es Phasen, da tippe ich Texte beinahe ausschließlich am Telephon. Ich kann nicht genau erklären, weshalb. Ich bin mir dann auch nicht sicher, ob das der beste Weg ist. Es ist jedoch gelegentlich einer, der funktioniert. Die Hemmschwelle ist die geringste. Ich kann dabei in der Hängematte liegen. Es ist weit von einer Arbeitsatmosphäre entfernt – weit genug um den nötigen Abstand zwischen das Projekt und meinen Kopf zu bringen. Es ist zwanglos. Ihm fehlt das Konkrete. Sein Urteil ist weicher als das von Papier.
Doch das Schreiben lässt sich auf weiteren Ebenen unterteilen. Eine ähnliche und doch gänzlich andere Unterscheidung lässt sich beim Inhalt eines geschriebenen Textes betrachten. Eine Information kann auf analoge bis digitale Weise divergent beschrieben werden. So kann das Verstreichen der Zeit beispielsweise von mathematisch t+60‘ über eine sprachlichere, aber immer noch sachlich, numerische Art eine Stunde später bis hin zu einem atmosphärischen „Einmal erschreckt uns Gebimmel einer Ziege, dann wieder Stille über schwarzen Hängen, die nach Pfefferminz duften, Stille mit Herzklopfen und Durst, nichts als Wind in trockenen Gräsern: Wie wenn man Seide reißt!“▼ als Art Analogie verfasst werden.
Möglicherweise lässt sich sogar die Intention einer Arbeit unterteilen: Während es mir leicht fällt analog eine Beschreibung persönlicher Umstände, beobachtete Ereignisse, eigene Gedanken oder Emotionen zu formulieren, scheint es mir gelegentlich unmöglich, die richtigen Worte für einen objektiven Sachverhalt zu finden. Das eine ist greifbar, kann aus der Erinnerung reproduziert oder gar direkt vom Auge übertragen werden – es ist das Abbild der eigenen, inneren Erfahrungswelt. Obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dass ich eine andere Person damit erreichen kann, wird darin keine eindeutige Information mit Wahrheitsanspruch kommuniziert. Der Interpretationsspielraum ähnelt dem einer Skizze im Vergleich zur konkreten Form einer Vektorzeichnung.
Die nüchterne Beschreibung eines Sachverhalts (eines Objekts oder Projekts) bildet ein Zwischending. Ich beschreibe, was ich vor mir sehe – was auch eine andere Person so sehr wahrscheinlich vor sich sehen würde.
Etwas gänzlich anderes ist es einen objektiven Sachverhalt mit Wahrheitsanspruch so zu formulieren, dass Individuen ihn unmissverständlich entschlüsseln können.
Das sogenannte wissenschaftliche Arbeiten macht mir Angst. Ein strukturierter Text macht mir Angst. Ich bin nicht im Stande meinen Tag von Morgens bis Abends zu planen, wie soll ich tausende Zeichen in eine sinnige Ordnung bringen? Wo ich bislang vor der Aufgabe stand einen spezifischen Text zu formulieren – eine Projektbeschreibung etwa, eine Erörterung oder Facharbeit – hatten diese von jeher vor allem eines gemeinsam: Sie waren kurz! Eine Masterthesis ist lang. Lang und anspruchsvoll. Anspruchsvoll und strukturiert. Strukturiert und fundiert. In meinem Kopf tobt jedoch das Chaos. Dinge geraten durcheinander; Namen verwehen wie Luft und Rauch. Ich war immer eine Leserin. Eine, die Geschichten, Eindrücke und Worte aufsaugt – aber selten etwas davon wieder hergibt; nur gelegentlich schwappt etwas über – direkt, ungefiltert und unsortiert. Davon abgesehen spreche ich wenig und schreibe noch weniger. Üblicherweise lese ich also anstatt zu schreiben und vor allem höre ich zu, anstatt zu reden. Jetzt finde ich mich in der Position eine Thesis zu verfassen (an das Kolloquium ist noch nicht zu denken!), die noch dazu in Teilen auf fremden Quellen fußt – in der sich also über meine eigenen auch die Thesen anderer geordnet finden sollen. Und an dieser Stelle wird es wirklich furchteinflößend! Was, wenn ich die Worte der Autorinnen oder Autoren versehentlich verdrehe, um sie in meine Sache einzupassen, falsch zitiere, darüberstolpere und ihren Gehalt verschütte? Darin ausrutsche und sie verwische? Eine wissenschaftliche Arbeit stellt Ansprüche, vor deren Größe ich mich klein fühle – in deren Tiefe ich fürchte unterzugehen.
Vor eben dieser Furcht flüchte ich mich gelegentlich in solche Texte.
Im übrigen ein exzellenter Wein – vielen Dank, Frau N!▲
J: Schönheit! T: Spar’s dir!▲
Stach, R. (2017): „Spektakuläre Einblicke in den Kopf eines Autors“. In: Deutschlandfunk Kultur (Hrsg.) (2017): Interview. URL (Abrufdatum: 02.12.2021).▲
Frisch, M (1957): Homo Faber. Deutscher Bücherbund, Stuttgart: 208▲